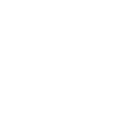ARBEIT
Begriff 1)
Zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste, körperliche und geistige Tätigkeit.
Ursprünglich war Arbeit der Prozess der Auseinandersetzung
des Menschen mit der Natur zur unmittelbaren Existenzsicherung; wurde mit zunehmender sozialer Differenzierung und Arbeitsteilung und der Herausbildung einer Tauschwirtschaft und Geldwirtschaft mittelbar.
In der Antike und im Mittelalter waren die Begriffsinhalte von Arbeit negativ und abwertend: Arbeit galt als unwürdige Tätigkeit, deren sprachliche Synonyme Mühsal, Plage, Last und Not waren; sie wurde dadurch zur Angelegenheit der unteren sozialen Schichten. Erst durch die christliche Religion erhielt Arbeit eine positive Bestimmung; bes. in der protestantischen Ethik ist Arbeit identisch mit Pflichterfüllung und gottgefälligem Tun, und in einer asketischen, durch Arbeit geprägten Lebensweise wird bereits im Diesseits die Vorbestimmtheit für die ewige Seligkeit sichtbar. Die positive Bewertung von Arbeit hat sich in den sich früh industrialisierenden westlichen Gesellschaften durchgesetzt; Weber (1864–1920) sah in der protestantischen Ethik die Voraussetzungen für den kapitalistischen Industrialisierungsprozess. Auch gegenwärtig wird Arbeit, auch Arbeitseinkommen und der sich darin dokumentierende Erfolg, positiv bewertet.
1) Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/arbeit-31465
Untaugliches Beispiel:
Soziologisches Seminar.
Thema: Der spielende Mensch als Abeitnehmer
Zielsetzung: Wir arbeiten über den Begriff Arbeit als Spaßelement, wobei hinterfragt werden sollte, ob imaginäre Gedanken der reinen Metaphysik noch zum Gegenständlichen tendieren bei zeitgleicher Neigung zum Abstrakten.
Der Austausch sich nicht manifestierender Elemente im geistig energetischen Umfeld könnte schlußendlich seine Selbstpurgation bedeuten.
Noch Fragen zur geistigen Form der Arbeit?
siehe geistiger Kalorienverbrauch (in 'Arbeit')
siehe auch Beschäftigung als Arbeit (in 'Arbeit')
Bildung ist die Fähigkeit, erworbenes Wissen anzuwenden, um daraus ein Wertebild zu formen:
Eine Ansicht der Gestaltung des Alltags, der Umwelt, der Gesellschaft etc.
Sonst handelt es sich nur um Ausbildung.
Kalendersprüche:
Man muß nicht nur sich selbst ins Gesicht sehen können, sondern auch anderen.
Wenn man sich selbst der wichtigste Mensch ist, hat man für die anderen nicht mehr viel Zeit.
Selbstmitleid nimmt auf Mitmenschen keine Rücksicht.
Recht hat nur der, der die eigenen Ansichten teilt.
Wer sein eigenes Ich überschätzt, wird in dessen Verteidigung blindwütig.
Nur wessen geistige Festung brüchig ist, hat für anderes außer deren vermeintlich notwendiger Verteidigung keine Kraft mehr.
Wenn ein Altruist hilft, darf das Opfer sich nicht wehren dürfen.
Wenn sich ein Samariter verletzt, könnte ein Pharisäer bluten. (aus dem Hebräischen)
Fortschritt von wo nach wo?
Die Bedeutung des Wortes
(nach dem Etymologischen Wörterbuch des Deutschen):
Fortschritt m. ‘Entwicklung vom Niederen zum Höheren, Zweckmäßigeren und vom Einfachen zum Komplizierten’. Zuerst (Ende 17. Jh.) grammatische Bezeichnung für den Geschlechtswandel von Substantiven, dann (18. Jh.) im Sinne von ‘Fortschreiten, Weiterschreiten, Vermehrung’ (s. fort sowie schreiten, Schritt) gebraucht. Nach 1830 wird Fortschritt unter Einfluß von frz. progrès zum Schlagwort der Politik und Philosophie im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Menschheit, das ‘Erreichen einer höheren Entwicklungsstufe’. fortschrittlich Adj. ‘voranschreitend, progressiv, für den Fortschritt eintretend’ (19. Jh.).
Damit ist also das Verlassen eines Zustands und der Eintritt in einen anderen gemeint. Wertfrei?
Voraussetzung ist die Beurteilung des einen wie des anderen. Welches aber sind die Parameter?
Sie können nicht absolut sein und haben damit eine politische soziale Bedeutung.
Sie könnten bedeuten:
vom Negativen weg zum Verbesserten
vom Bewährten weg zum nicht eingeschätzten Risiko hin
...............
Jedenfalls abhängig von allem, was die menschlichen geistigen und emotionalen Fähigkeiten ausmachen, also fragwürdig.