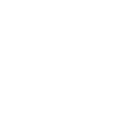Einige Eindrücke aus einer Zeit, die durch ein Treffen mit Georg Hartung, einem Schulfreund, wieder lebendig wurden. Georg hatte einige Aufzeichnungen gemacht, die er mir zur Verfügung stellte und auch zur weiteren Verwendung freigab. Diese Erinnerungen umfassen so viele meiner eigenen Erinnerungen, dass ich sie nur mit marginalen Gedanken ergänze.
Dr. G. Hartung
Erlebnisse in einer Trümmerlandschaft.
Die St. Andreas-Kirche war nach dem letzten Bombenangriff am 22. März 45 recht stark zerstört. Den Turm konnte man nur unter Lebensgefahr besteigen. Zum Sammeln von Brennholz habe ich von dort oben Balkenreste hinunter geworfen. Durch den Aufprall waren sie häufig schon zu Kleinholz zersplittert und ließen sich auf dem Bollerwagen gut abtransportieren.
In den Kirchenfenstern hingen noch Bleirippen von der Bleiverglasung. Diese Bleirippen haben wir mit einer Zange in kleine Stücke zerkniffen und sie als gefährliche Geschosse für die selbst gebaute Zwille
benutzt. Reste der kupfernen Regenrohre haben wir in der Goschenstraße bei einem Altwarenhändler gegen geringes Geld verhökert.
1946 oder 47 ist in der Innenstadt zur Räumung des Schutts eine „Trümmerbahn“ gebaut worden. Die Gleise für die Loren, die von einer kleinen Lokomotive gezogen wurden, waren nur sehr locker verlegt. Die Hauptstrecke dieser Bahn verlief vom Pelizaeus-Platz über den Hohen Weg und die Almstraße.
Abends standen manchmal noch einige Loren auf dem Hohen Weg vor dem Haus von Lindemann (jetzt Buchhandlung Decius). Die Loren waren recht groß und schwer. Wir Jungen im Alter von 11-13 Jahren haben die Kupplungen gelöst und sind dann auf einer der Loren die abschüssige Strecke bis zum Almstor hinunter gefahren. Zum Bremsen hatten wir einen dicken Knüppel, den wir zwischen Achse und Rad klemmen konnten. Es war sehr gefährlich, hat aber viel Spaß gemacht.
Als Josephiner (1945/46) hatten wir wochenweise wechselnd vormittags oder nachmittags Unterricht auf dem Moritzberg (Gelbe Schule, Gasthaus Brauhaus oder Brauhaus-Schule). Der Weg dorthin war für mich aus der Einumer-Straße sehr weit und führte über die Innerste. Von der Bischofsmühlen-Brücke existierten nur noch einige verbogene Eisenträger. Dort sind wir Schüler mit dem Tornister unter dem Arm –weil die Riemen schon fehlten- rüberbalanciert. Wegen der vielen Trümmer war die Innerste dort aber nicht sehr tief. Nur im Winter war ein Absturz wegen der nassen, kalten Füße sehr ärgerlich. Zwei Klassenkameraden, Franz Tesch und sein Cousin Franz Waber, waren mit ihren Müttern aus Schlesien in Bettmar in ehemaligen Tagelöhnerhäusern untergekommen. Weil sie nur ein Paar Schuhe hatten, die geschont werden mussten, sind sie barfuß von Bettmar bis zum Moritzberg gegangen und haben erst kurz vor der Schule die Schuhe wieder anziehen können.
Weil unsere Fahrräder alle gestohlen waren, habe ich ein Uralt-Fahrrad wieder gängig gemacht.
Die „Wulst-Fahrraddecken“ wurden an defekten Stellen mit Resten überdeckt. Beim Bremsen auf der Bergstraße runter konnte es passieren, daß man eine Rolle vom Fahrrad machte, weil die Bremse an den Flicken stoppte.
Wegen der Blockierung des Treibe- und Sültebaches durch Bombentreffer standen 1945/46 große Teile der Innenstadt Hildesheims unter Wasser. Ich habe einmal in einem Keller ohne Fenster ein Bett auf Backsteinen gestellt gesehen, wo jemand gewohnt hat während der Fußboden unter Wasser stand.
Kurz nach dem letzten Bombenangriff am 22.03.45 bin ich trotz der noch herrschenden Hitze bis zum Marktplatz vorgedrungen und habe dort einige Brandleichen und einen verbrannten Löschwagen der Feuerwehr gesehen.
Wenige Tage später habe ich auf dem Marktplatz an einem Galgen die gehängten angeblichen „Plünderer“ gesehen. Das sind Eindrücke, die man nicht vergisst.
Als der Dom in Hildesheim wieder aufgebaut wurde, konnte man über die Gerüste leicht auf den Dachboden steigen. Der Beton der Decke war frisch gegossen. Also haben wir unsere Fußabdrücke
- wie die Filmgrößen in LA – dort verewigt und auch noch herum liegendes Handwerkszeug im Beton verbuddelt.
Zum Wiederaufbau des Josephinums mussten wir Schüler nachmittags Backsteine vom Mörtel befreien. Dazu hatten wir alte Heizungsradiatoren, auf deren Rippen wir den Mörtel abgeschrubbt haben. Zwischendurch haben wir den noch erhaltenen Weinstock vom Hausmeister Erich Wegener von saueren Weintrauben erleichtert. Was ihn immer wieder in Wut gegen uns gebracht hat. Beim Austeilen der Schulspeisung in die Kochgeschirre für die Saxonia-Turner war er jedenfalls immer recht großzügig.
-
steigen. Zum Sammeln von Brennholz habe ich von dort oben Balkenreste hinunter geworfen. Durch den Aufprall waren sie häufig schon zu Kleinholz zersplittert und ließen sich auf dem Bollerwagen gut abtransportieren.
In den Kirchenfenstern hingen noch Bleirippen von der Bleiverglasung. Diese Bleirippen haben wir mit einer Zange in kleine Stücke zerkniffen und sie als gefährliche Geschosse für die selbst gebaute Zwille
benutzt. Reste der kupfernen Regenrohre haben wir in der Goschenstraße bei einem Altwarenhändler gegen geringes Geld verhökert.
1946 oder 47 ist in der Innenstadt zur Räumung des Schutts eine „Trümmerbahn“ gebaut worden. Die Gleise für die Loren, die von einer kleinen Lokomotive gezogen wurden, waren nur sehr locker verlegt. Die Hauptstrecke dieser Bahn verlief vom Pelizaeus-Platz über den Hohen Weg und die Almstraße.
Abends standen manchmal noch einige Loren auf dem Hohen Weg vor dem Haus von Lindemann (jetzt Buchhandlung Decius). Die Loren waren recht groß und schwer. Wir Jungen im Alter von 11-13 Jahren haben die Kupplungen gelöst und sind dann auf einer der Loren die abschüssige Strecke bis zum Almstor hinunter gefahren. Zum Bremsen hatten wir einen dicken Knüppel, den wir zwischen Achse und Rad klemmen konnten. Es war sehr gefährlich, hat aber viel Spaß gemacht.
Als Josephiner (1945/46) hatten wir wochenweise wechselnd vormittags oder nachmittags Unterricht auf dem Moritzberg (Gelbe Schule, Gasthaus Brauhaus oder Brauhaus-Schule). Der Weg dorthin war für mich aus der Einumer-Straße sehr weit und führte über die Innerste. Von der Bischofsmühlen-Brücke existierten nur noch einige verbogene Eisenträger. Dort sind wir Schüler mit dem Tornister unter dem Arm –weil die Riemen schon fehlten- rüberbalanciert. Wegen der vielen Trümmer war die Innerste dort aber nicht sehr tief. Nur im Winter war ein Absturz wegen der nassen, kalten Füße sehr ärgerlich. Zwei Klassenkameraden, Franz Tesch und sein Cousin Franz Waber, waren mit ihren Müttern aus Schlesien in Bettmar in ehemaligen Tagelöhnerhäusern untergekommen. Weil sie nur ein Paar Schuhe hatten, die geschont werden mussten, sind sie barfuß von Bettmar bis zum Moritzberg gegangen und haben erst kurz vor der Schule die Schuhe wieder anziehen können.
Weil unsere Fahrräder alle gestohlen waren, habe ich ein Uralt-Fahrrad wieder gängig gemacht.
Die „Wulst-Fahrraddecken“ wurden an defekten Stellen mit Resten überdeckt. Beim Bremsen auf der Bergstraße runter konnte es passieren, daß man eine Rolle vom Fahrrad machte, weil die Bremse an den Flicken stoppte.
Wegen der Blockierung des Treibe- und Sültebaches durch Bombentreffer standen 1945/46 große Teile der Innenstadt Hildesheims unter Wasser. Ich habe einmal in einem Keller ohne Fenster ein Bett auf Backsteinen gestellt gesehen, wo jemand gewohnt hat während der Fußboden unter Wasser stand.
Kurz nach dem letzten Bombenangriff am 22.03.45 bin ich trotz der noch herrschenden Hitze bis zum Marktplatz vorgedrungen und habe dort einige Brandleichen und einen verbrannten Löschwagen der Feuerwehr gesehen.
Wenige Tage später habe ich auf dem Marktplatz an einem Galgen die gehängten angeblichen „Plünderer“ gesehen. Das sind Eindrücke, die man nicht vergisst.
Als der Dom in Hildesheim wieder aufgebaut wurde, konnte man über die Gerüste leicht auf den Dachboden steigen. Der Beton der Decke war frisch gegossen. Also haben wir unsere Fußabdrücke
- wie die Filmgrößen in LA – dort verewigt und auch noch herum liegendes Handwerkszeug im Beton verbuddelt.
Zum Wiederaufbau des Josephinums mussten wir Schüler nachmittags Backsteine vom Mörtel befreien. Dazu hatten wir alte Heizungsradiatoren, auf deren Rippen wir den Mörtel abgeschrubbt haben. Zwischendurch haben wir den noch erhaltenen Weinstock vom Hausmeister Erich Wegener von saueren Weintrauben erleichtert. Was ihn immer wieder in Wut gegen uns gebracht hat. Beim Austeilen der Schulspeisung in die Kochgeschirre für die Saxonia-Turner war er jedenfalls immer recht großzügig.
Dr. Georg Hartung
Meine Kindheit und Jugendjahre I
Am 16. März 1935 habe ich in Velbert das Licht der Welt erblickt. Dort war mein Vater Volkschullehrer. Meine Mutter hat mir erzählt, daß sie nach meiner Geburt von draußen oder vom Radio Marschmusik gehört habe. Man hat ihr gesagt, an diesem Tage habe Adolf Hitler die allgemeine Wehrpflicht- entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrages- wieder eingeführt. So habe ich den Namen des Patrons der Soldaten Georg erhalten. Meine Taufpaten waren Onkel Heinrich Nolte,(Lehrer) der Mann von der Schwester meiner Mutter und eine Freundin meiner Mutter: Frau Bornewasser aus Velbert. Die Taufkirche war St. Marien in Velbert.
Nach dem Umzug der Familie nach Hildesheim ist meine erste Erinnerung an eine Flucht vor meinem jüngeren Bruder Manfred, Brüderchen genannt, der zweijährig mit einem Stein in der Hand, mich um ein rundes Rasenbeet verfolgt hat.
Leider ist mein jüngerer Bruder bald darauf im Nachbarsgarten zu unserem gepachteten „Großen Garten“ in eine ungesicherte Regentonne, die bis auf einen kleinen Rand in die Erde eingegraben war, gestürzt und ertrunken. Ich kann mich noch erinnern, daß mein Vater unweit der Unglücksstelle damit beschäftigt war, mir einen Apfel zu schälen. Während mein Vater mit Wiederbelebungsversuchen keinen Erfolg hatte, hat er mich mit der Unglücksmeldung nach Hause geschickt. Ich bin den weiten Weg gerannt und fand meine Mutter im Hausflur im Gespräch mit einer Nachbarin. „Brüderchen ist tot“ habe ich gerufen.
In der Folgezeit erinnere ich mich an lange Fußmärsche zum Friedhof und langweilige Stunden am Grabe meines Bruders. Manchmal habe ich mir die Zeit damit vertrieben, auf den Mauern der benachbarten Grabmäler zu balancieren.
Mein Vater musste schon 1938 als Reserveoffizier zu Wehrübungen einrücken. Bis zur Entlassung aus der Gefangenschaft 1946 oder 47 habe ich ihn nur gelegentlich – und dann in Uniform - gesehen, wenn er auf Urlaub kam.
Meine beiden wesentlich älteren Brüder hatten Klavierstunden bei Bella Borgmeyer in der Kreuzstraße/ Ecke Kläperhagen (dort wo später das „Asia-Restaurant war). Manchmal haben sie mich mitgenommen. Vielleicht wollte meine Mutter mal Ruhe haben !? Die Tanzstunden meiner Brüder bei Editha Meyer fanden in Hotopps Hotel, später im Gasthaus „Goldener Engel“ auch in der Kreuzstr. statt. Es war ein schöner Fachwerkbau. Dort steht heute der Neubau des Landessozialamtes (früher Bezirksregierung). Auch dorthin mussten mich meine Brüder als lästigen „Anstands-Wau-Wau“ mitnehmen. Herta Ringeltaube aus Bad Salzdetfurth war der Schwarm meines Bruders Felix. Hausbälle waren damals große Mode. Sie fanden bei uns im Haus statt. Wir hatten große Räume mit Parkettfußboden. Die Möbel wurden irgendwie an die Seite geräumt. Ich hatte das geliehene Grammophon zu bedienen und durfte daher länger aufbleiben. Daher habe ich auch die damals gängigen Schlager noch gut in Erinnerung.
An darauf folgenden Tagen hat meine Mutter weinend das Parkett von Spuren gereinigt. Als es wieder eingewachst und sauber war, musste ich mich auf den eisernen Bohnerbesen zur Beschwerung setzen. Dann haben meine Brüder das Parkett gebohnert.
Schon im Rheinland sind meine Brüder im „Jungvolk“ gewesen. (Schwarze Siegrune auf gelbem Grund am Ärmel der Uniform. Später schwarz auf rotem Grund) Daran kann ich mich noch entsinnen. Beide Brüder waren Fähnleinführer. Uli leitete das Fähnlein 3 „Franz von Sickingen“ und nahm mich manchmal zu Heimabenden mit, die in einem Haus in der Schuhstr./ Ecke Kramerstr. stattfanden.
Vorher musste ich aber Jungvolklieder auswendig gelernt haben.
Die Fähnleinführer durften länger als bis zum 16.Lebensjahr beim Jungvolk sein. In die darauf folgende HJ wollten nur wenige. Mein Bruder Felix hat sich geweigert, dort zum Dienst zu gehen. Eines Tages kam ein HJ-Führer zu uns ins Haus. Ich hatte ihm die Tür geöffnet. Er fragte meine Mutter, warum ihr Sohn nicht zum Dienst erschiene. Aus dem oberen Treppenhaus rief mein Bruder: „Der ist doof!“
Unsere Nachbarn waren Neubert, mit denen wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatten. Oft war meine Mutter mit mir in deren Küche zum Klönen. Der Mann war Bezirksschornsteinfegermeister und früherer Sozialdemokrat. Seine beiden Söhne waren Mitglieder der „Schwarzen SS“, später als Soldaten in der Waffen-SS. Im Urlaub hat mir einer der Söhne in dem aufgebockten Auto des Vaters –die Reifen waren von der Wehrmacht beschlagnahmt worden- das Autofahren in einem „Trockenkursus“ beigebracht. Einer der Söhne ist als Gefangener in Jugoslawien umgebracht worden; der andere ist aus russischer Gefangenschaft heim gekehrt.
Auf unserem Grundstück Einumerstr. 76 hatten wir einen Pferdestall mit Pferde- Burschenzimmer. Die 2 Doppelhäuser Nr. 75/76 und 77/78 waren als Häuser für Offiziere konzipiert. Dort war zeitweise das Jungvolkheim des Fähnlein 3. An die weiße Zimmerdecke hatte mein Bruder Uli mit Kerzenruß etwas an die Decke gemalt: „Blut und Ehre“ oder ein Schwert. Ich weiß es nicht mehr genau und er auch nicht. Ich habe ihn heute danach befragt.—Die grüne dicke Tür zum Burschenzimmer war von Luftgewehrgeschossen, die wir Pinns nannten, zernarbt. Pinns waren Stahlgeschosse mit einer langen Spitze und einem Federbüschel hinten. Manchmal musste ich eine Winterbluse mit Metallknöpfen anziehen, mich an die Tür stellen und dann wurde mit Diabolo-Kugeln auf meine Knöpfe geschossen. Das hat manchmal ein bisschen weh getan. Einige der eingebeulten Knöpfe habe ich noch aufgehoben.
Den Kriegsausbruch 1939 habe ich sitzend auf einem unserer Torpfosten erlebt. Die Truppen fuhren oder marschierten durch die Einumerstr. an unserem Haus vorbei; die Ordonanzen galoppierten auf ihren Pferden den Bürgersteig entlang. Das sah toll aus !!
Am „Tag der Wehrmacht“ war ich natürlich in den Kasernen und habe mit MG und Granatwerfer geschossen und die Gefechtsvorführungen der Truppe begeistert beobachtet. Mein Vater hatte ja immer Revolver und Gewehre im Haus. Unter Ulis Anleitung habe ich im Hof gelernt, mit Waffen umzugehen. Für den Colt .44 brauchte ich am Abzug zwei Finger, wenn ich auf meine Spielzeug-JU 52 schießen wollte. Als Kugelfang diente eine hohe Backsteinmauer zu unserem Nachbarn.
1941 bin ich in die Moltkeschule gekommen. Wir hatten eine Öffnung im Zaun zum Schulhof, der hinter unserem Garten lag. So war mein Schulweg nicht weit. Auf der Schultoilette bin ich nie gewesen, sondern schnell nach Hause gelaufen. Im ersten Schuljahr haben wir bei Herrn Lehrer Hobrecht in Sütterlin-Schrift das Lesen und Schreiben gelernt. Ein Jahr später wurde die lateinische Schrift eingeführt. Bei „Luftgefahr 15“ d.h. feindliche Flugzeuge waren nur 15 Minuten Flugdauer von Hildesheim entfernt, mussten wir nach Hause gehen. Dann stand ich manchmal ohne Haustürschlüssel vor der verschlossenen Haustür und habe auf meine Mutter geschimpft, die nicht zu Hause war und mir keinen Schlüssel anvertraute. Gelegentlich habe ich es geschafft, die schlecht verschlossene Balkontür mit einer Bindfadenschlinge „aufzubrechen“.
Während des Krieges habe ich mir von Herrn Neubert Kehrbesen mit Kugel ausgeliehen, bin damit auf das Pferdestalldach geklettert und habe den Kamin gefegt. Bei einer solchen Gelegenheit habe ich einen Luftkampf gesehen. Eine englische Spitfire hat einen deutschen Flugschüler abgeschossen, der zwischen Uppen und Ottbergen notgelandet ist. An dem Flugzeug bin ich auf der Wallfahrt nach Ottbergen öfter vorbei gekommen. Der Fluglehrer hat dann den Engländer abgeschossen, der mit dem Fallschirm über Emmerke abgesprungen ist. Leider habe ich mit dem Besen in die Kämpfe nicht eingreifen können.
In unserem „großen Garten“ habe ich bei der Ernte von Äpfeln, Pflaumen und Sauerkirschen, Himbeeren, Erbsen und Bohnen mithelfen müssen. Das war für mich langweilige Arbeit. Lieber habe ich Schützenlöcher und –Gräben gebuddelt. Beim Gerüst für die Stangenbohnen musste ich wie ein Affe auf die noch wackeligen Stangen klettern und die Stangen oben mit Bindfaden verbinden. Mein Vater hatte einen großen Misthaufen im Garten angelegt und hinterlassen. Meine Mutter hat Klassenkameraden meines Bruders Felix gegen Bezahlung angeheuert, diesen Misthaufen abzutragen. Der war sicher 2-3 Meter hoch. Die jungen, kräftigen Burschen haben mich auf ihre Schaufel gesetzt und mich im hohen Bogen in ein frisch umgegrabenes Feld fliegen lassen. Spaß hat das gemacht! Hätte auch schief gehen können.--
Der Garten lag an einer Eisenbahnstrecke. Manchmal habe ich Pfennigstücke auf die Schienen geklebt. Wenn dann ein Militärzug mit Panzern beladen über die Pfennigstücke gerollt ist, waren die so ausgewalzt wie 5 Markstücke und hauchdünn. Die Lokomotivführer haben mich manchmal nach einem Halt für eine Tüte Obst auf der Lok eine Strecke mitfahren lassen.
Mit meinem Freund Hans Wessel, der wenige Häuser weit von uns wohnte, haben wir zusammen in deren Küche mit einer aufziehbaren Eisenbahn gespielt. Die Gleise liefen unter dem –damals in jeder Küche obligatorischen- Sofa mit Fransen her. Um den Eisenbahnverkehr etwas realistischer zu gestalten, haben wir Papier in den Lokomotivschornstein gesteckt und angezündet.—
Augenblicke
Während meiner Volksschulzeit hatte ich verschiedene Freunde: Manchmal habe ich täglich mit Hans Wessel gespielt (Einumerstr. 68 III.Etage; über einige Zeit war ich fast an jedem Nachmittag in der Lessingstraße und habe mit Gerhard Heise, Hanjo Gebert (meine Klassenkameraden) Heinzi Nothrof und seinen vielen Brüdern, Bertold Ossenkopp und Moni Sarstedt und einigen anderen im Sommer bis zum Einbruch der Dunkelheit „Grenzball“ oder „Schlagball“ gespielt. Im Winter haben wir Iglus gebaut, die manchmal durch Gänge unter Schnee mit einander verbunden waren. Unsere „Feinde“ waren die Jungen aus der Schillerstraße ( Bütefisch und Konsorten), die alle ziemlich kräftig waren.
Hanjo:
Auch die Schillerstraße hatte Iglus. Komfortabler ausgestattet. Sofas. Feindlich. Sie wurden von uns eingenässt. Eben feindlich. Ich kann mich an die Folgen nicht erinnern.
Georg:
Da es während des Krieges kaum Autoverkehr gab, konnten wir in der Lessingstr. „Grenzball“ gespielt: 2 Manschaften, die einen Tennisball möglichst weit in oder über die gegnerische Mannschaft werfen mussten. Wurde der Ball mit beiden Händen gefangen, dann durfte der Fänger 3 Schritte vor und von dort den Ball zurück werfen. Mit der rechten Hand gefangen, brachte 6 Schritte Vorsprung, mit der linken Hand gefangen: 9 Schritte. Moni Sarstedt, Bertold Ossenkopf und ich waren gute Werfer.
Hanjo:
Die Lessingstraße war überhaupt in dieser Zeit unserer Hauptspielstraße, was natürlich mit viel Lärm verbunden war und die Anwohner zu entsprechenden Aktionen veranlasste. Eine solche Aktion bestand darin, die Polizei zu rufen, die uns in geordneter Marsch Formation zur Wache brachte, damals im Gebäude der Gestapo. Obwohl mein Bruder mir unterwegs mehrfach ein Zeichen gab abzuhauen, habe ich mich nicht getraut, mich dem Zugriff der Obrigkeit zu entziehen. Das ganze ist dann mit einer entsprechenden Verwarnung und dem Ratschlag, sich möglichst schnell zu entfernen, ausgegangen.
Es gab in der Lessingstraße allerdings auch Jugendliche, die älter waren als wir und denen wir so gut wie ausgeliefert waren. Natürlich haben wir das nicht ohne versuchte Widerstände hingenommen. Unsere „Rache“ bestand zum Beispiel darin, einen dieser älteren zu beschimpfen, wenn er sich in sicherer Entfernung zu uns am Fenster in der ersten Etage aufhielt. Seine entsprechende Antwort bestand zum Beispiel darin, die „Leberle" aufzuzählen, die er uns verabreichen würde, sobald er unserer habhaft würde. Ein Leberle bestand aus einem Stoß mit dem Knie in die entsprechende Körpergegend, ein harter Brauch.
Es ging nunmal nicht so zimperlich zu, was die damals noch gemäßigten Straßenkämpfe mit der Schillerstraße beweisen.
Georg:
In der Einumerstraße Nr. 95 (weiter zur Innenstadt hin) stand ein großes Haus Fa. Geese –Heizungsbau- neben Kohlen- und Getreidehandlung Kolthoff.
–Einumerstr. Nr.100 war eine kleine Kneipe, die aber in Kriegszeiten geschlossen war-.
Dieses Haus Geese hatte einen großen Luftschutzkeller. Am 03.03.1945 ist es von einer Luftmine getroffen worden, die wohl durch das weiträumige Treppenhaus geflogen und erst im Keller explodiert ist. Dort sind viele Leute umgekommen. Auch eine Tante meines Freundes Hans Wessel –Frau Schneider mit ihrem Kleinkind-. Sie wohnte schräg gegenüber; ihr Haus ist heil geblieben. Ihr Mann war Polsterer und zu der Zeit Soldat an der Ostfront. Wegen des Todes seiner Familie hat er Sonderurlaub erhalten, hat sich den Trümmerberg angesehen und ist eher als notwendig wieder an die Front gefahren!! Später ist er aus russischer Gefangenschaft zurück gekehrt und hat auch noch für uns gearbeitet.
Hanjo:
Wir haben Jugendliche gekannt, die im Keller umgekommen sind. Seitdem spätestens ist mir der Begriff Phosphor bekannt.
Georg:
Auf diesem Trümmerberg habe ich mich mit einigen Freunden aus der Lessingstraße im Sommer 1945 eingenistet, denn auf einem gegenüber liegenden Trümmerhaufen Ecke Einumer-/Pieperstraße hatten sich die Jungen aus der Schillerstraße festgesetzt. Über die Straße hinweg haben wir uns mit Steinen beworfen. Zum Teil hatten wir Stahlhelme auf. Selbst durchfahrende amerikanische Armee-Lastwagen haben uns dabei nicht gestört.
Als der Tag zur Neige ging, war ich nur noch der einzige „Kämpfer“ auf der südlichen Seite der Einumerstraße. Ich hatte meine Rollschuhe dabei und wollte auch nach Hause. Auf den Trümmern waren sie eher hinderlich. Dann haben mich die Jungen der Schillerstraße abgefangen und ordentlich „verlascht“.
Die Ersatz-Kugellager für Rollschuhe haben wir damals nur gegen Spielsachen im Tausch bekommen können, wenn Rollschuhe aus anderen Ursachen kaputt gegangen waren z.B. wegen abgefahrener Stahlreifen.
Die Telefonleitungen waren bis lange nach dem Krieg vorwiegend überirdisch. In der äußersten Ecke des „Alten Gartens“ neben dem Schulhof der Moltkeschule/Elisabethschule (jetzt Spiel/Sportplatz) stand ein Telephonmast mit Sicherungskasten. Der Mast hatte Sprossen rechts und links und oben eine Sitzleiste. Mit Feldtelefon und Kopfhörer bewaffnet bin ich manchmal abends in der Dunkelheit auf den Mast geklettert und habe mich „eingeklinkt“ und auf Telefongespräche zum Mithören gewartet. Das Ergebnis war nicht spannend, eher langweilig !!
Ein Freund meines Vaters, Herr Erich Lehnhoff, war Bürstenmacher. Da seine Werkstatt in der Osterstraße ausgebombt war, hat er eine kleine Werkstatt in unserem Pferdestall in der Einumerstraße eingerichtet. Mein Vater und ich haben gelegentlich dort ausgeholfen. So habe ich neben der Schule auch das Besenbinderhandwerk gelernt. Selbst als Student habe ich mir manchmal Geld damit verdient.
Mein Freund, Hans Wessel, hatte einen Onkel, Herrn Mosel (umgetaufter Moses), der am Neustädter Markt Pferdeschlachter war. Der brauchte einen Besen. Ein Pferdeschweif wurde geliefert. Den habe ich habe eingebunden und zur Versteifung der Haare in eine Lösung gelegt. Dort sollte er eigentlich über einige Wochen liegen. So lange hatten wir natürlich keine Zeit. Wir brauchten Geld !! Nach 2 oder 3 Tagen habe ich den Besen gebunden. Die Pferdehaare waren noch etwas kraus und weich. Aber der Besen sah schon ganz schön aus und hat uns 5 oder 10 DM gebracht. Lange wird Herr Mosel daran keine Freude gehabt haben.--
Hanjo:
Der Bürstenmacher ist mir auch noch vertraut, zumal dessen Werkstatt unter einem Raum im darüberliegenden Dachgeschoss lag, in dem wir Freunde etliche Zeit verbracht haben. Die Lehmschicht zwischen den Balken des Bodens sollten noch eine Rolle spielen
Georg:
Eine Begebenheit muß ich noch anfügen. Wir hatten in jedem Zimmer (des Wohnhauses) einen großen Kachelofen. Wegen des Mangels an Kohle (und Geld) konnte außer der Küche nur in einem Zimmer der Ofen geheizt werden. Gegen Abend wurde es dann erst gemütlich warm. Meine Mutter hat gelesen, und ich habe mit meinen (Elastolin) Soldaten gespielt, von denen ich sicher über Hundert hatte. Irgendwann war meine Mutter dann müde und hat sich schlafen gelegt. Ich durfte weiter spielen, weil der „Krieg“ ja wichtig war !! Nach einiger Zeit war es mir zu still und einsam, und dann bin ich auch ins Bett gekrochen.
Die Roste der Kachelöfen gingen natürlich auch mal kaputt. Meine Mutter bat den Ofensetzer Baule vom Neustädter Markt um Hilfe. Der schickte einen französischen Gefangenen zu uns, der die Reparatur machte. Meine Mutter sprach gerne Französisch und ist mit ihm ins Gespräch gekommen. Ob er Ofensetzer sei und wo er zu Hause wäre. Er war Weinbauer und kam aus Süd-Frankreich. Zum nächsten Kunden durfte er aber nicht alleine gehen. Also habe ich als „Bewachung“ den guten Mann als 7 oder 8 jähriger Junge zum nächsten Arbeitsort begleitet. Ob ich seine Hand genommen habe oder er mich an der Hand geführt hat, weiß ich nicht mehr genau.
(Nach Kriegsende mussten alle Frauen den Schutt von den Straßen räumen. Meine Mutter war in der Braunschweiger Straße eingesetzt. Ich musste mit und hatte meine Spitzhacke dabei. Dabei habe ich in den Trümmern natürlich die Ofenroste aus den kaputten Kachelöfen gerettet und mit nach Hause genommen.)
An der Zingel neben der Zentralbank waren französische Gefangene untergebracht. Einmal bin ich mit einem Freund dort gewesen. Die Franzosen bekamen damals Päckchen von ihren Angehörigen über die Schweiz zugeschickt. Sie haben mir Schokolade geschenkt, die ich gar nicht mehr kannte.
Hanjo:
Ja, Dieses Gefangenenlager lag im Gartengelände des Hauses, in dem meine Großmutter wohnte und ich meinen Daueraufenthaltsplatz mit meinem kindlichen Privatbesitz hatte. Als Kinder haben wir manche Zeit zwischen den Gefangenen im Lager verbracht und zum Beispiel gelernt, wie man es Geschirr (Blech) mit Sand reinigen kann. Im Haus vorne waren auch zwei gefangene Handwerker untergebracht, ich glaube Schuster und Schneider, die für uns hin und wieder kleine Arbeiten verrichteten und mit denen wir Kinder gut zurecht kamen.
Mit dem Luftangriff am 22. März 1945 wurde das jedoch alles zerstört.
In Erinnerung geblieben sind mir die geschmolzenen Einmachgläser im ausgebrannten Keller des Gebäudes geblieben .
Georg:
Der Winter 1941/42 war sehr kalt. Lange Zeit über waren die Straßen vereist. Wir konnten mit dem Schlitten vom Galgenberg-Restaurant bis zur Goslarschen Straße mit dem Schlitten abfahren. Wenn Uli dabei war, haben wir einen Bob aus 2 Schlitten gemacht. Ich musste als Beschwerung auf dem vorderen kleinen Schlitten sitzen; mein Bruder Uli hat gelenkt. Ich aber bekam die Schneebälle ab, die die aufwärts ziehenden Rodler gegen uns warfen. Früh an jedem Morgen stand Herr David, der Polizist, vor unserer Tür und hat uns aufgefordert, das Eis auf dem Gehweg zu entfernen. Das habe ich mit einem Stemmeisen gemacht. In der Lessingstraße haben wir Iglus gebaut.
Mein Vater hatte mir verboten, auf den Kalo zum Schlittschuhlaufen zu gehen. Das lockte aber doch sehr. So bin ich mit „Hackenreißer-Schlittschuhen“ an vorne aufgeschnittenen Schuhen (weil die schon zu klein waren) auf den Kalenberger Graben gegangen. Ein Klassenkamerad hat mich bei meinen Eltern verpfiffen. Mein Vater hat mich bei der Heimkehr über das Knie gelegt und verprügelt. Ein einmaliges Erlebnis in meinem Leben. Später habe ich einen Jungen, der im Eis eingebrochen war, aus dem Kalo gerettet. Der ist sofort weggelaufen; ich musste warten bis meine nassen Klamotten gefroren waren. Keiner hat mir eine Lebensrettungs-Medaille verliehen !!
Während des Krieges ist mein Bruder Uli auf der Fahrt von Holland zur Ostfront als Panzermann für ein oder zwei Tage in Hildesheim gewesen. Dafür hat er später bei der Truppe Ärger bekommen. Mit seinem Karabiner habe ich mit leeren Patronenhülsen Schießübungen veranstaltet. Irgendwie ist eine Hülse verklemmt und ich habe den Verschluß nicht mehr öffnen können. Den Karabiner habe ich einfach in die Ecke gestellt und habe meinem Bruder nichts gebeichtet. Bei der Truppe hat er wohl vom Waffenmeister einen „Anschiß“ bekommen, dafür aber eine MP für den Einsatz im Panzer erhalten.
Im Winter 44/45 hat es an unserer Haustür geklingelt. Ich habe die Tür geöffnet und vor mir stand ein Soldat in einer abgerissenen Luftwaffenuniform mit seinem linken Arm in einer Bindfadenschlinge: Uli. Mein Bruder war als Verwundeter aus einem Lazarett in Ingolstadt abgehauen, weil alle Verwundeten in die NSDAP eintreten sollten. Nun war „Holland in Not“. Gott sei Dank, kannte meine Mutter den Chef der Lazarette in Hildesheim, Dr. Trost. Der hat meinen Bruder nachträglich angefordert und in die Sülte verlegt. Dort habe ich Uli wiederholt besucht.
Während des Krieges gab es keine vernünftigen Schuhe. Die Holzsandalen habe ich nicht gerne getragen, weil man darin nicht schnell laufen konnte. Beim Springen zerbrachen die Sohlen schnell. Mein Vater hat mir einmal ein Paar vornehme, englische Schuhe geschickt, als er auf der Kanalinsel Jersey stationiert war. Diese Schuhe habe ich beim Spielen auf dem Bismarckplatz ausgezogen und sofort waren sie gestohlen !! Dann hat mein Vater ein Paar Kavalleriestiefel, die niemandem in seiner Kompanie passten, mit nach Hildesheim gebracht. Die beiden Stiefel hatten verschiedene Größen. Die langen Schäfte habe ich zum Teil nach innen eingeklappt, weil sie mir bis über die Knie gingen. Mit 3 Paar Socken haben sie mir gepasst. So bin ich mit Nagelstiefeln herum gelaufen und sonntags in die Kirche gegangen. Nach dem Krieg habe ich mir von zerstörten Flugzeugen aus den Reifen Stücke mit Mühe abgeschnitten und daraus Sandalen gefertigt. Die waren aber dick und gebogen und man konnte nicht über längere Zeit damit laufen.
Fahrrad und Bollerwagen waren zu Kriegs- und Nachkriegszeiten unsere wichtigsten Transportmittel. Im Sommer bin ich mit meiner Mutter oft zum Schwimmen im Müggelsee nach Drispenstedt gefahren.
Dem Eingang der Badeanstalt gegenüber war ein Zweigwerk der Fa. Kattentidt. Dort arbeiteten russische Kriegsgefangene hinter hohem Stacheldrahtzaun. Abends saßen sie am Zaun und sangen zur Ziehharmonika. Es tut mir heute noch leid, daß ich nicht daran gedacht habe, ihnen mal einige Äpfel über den Zaun zu werfen, von denen wir genügend hatten.
Meine Großeltern Heseler wohnten bis zu ihrem Tode in der oberen Etage Einumerstr. 76. Beide waren immer schwarz gekleidet. Meinen Großvater kenne ich nur mit „Gehrock und Melone“ Meine Brüder nahmen mich manchmal mit in ihr Versteck. Das war über den oberen Balken unseres Speiseaufzuges, der von der Küche im Keller bis in das Hochparterre ging. Es war eigentlich lebensgefährlich sich dorthin am Seil hoch zu hangeln.
Etwa 1940 verfügte das Luftschutzamt die Räumung aller Hausdachböden von brennbarem Material. Also hat mein Bruder Uli Mengen von alten Zeitungen und Geldscheinen der Inflationszeit die Bodentreppe hinunter geworfen. Alle Treppen waren dick mit Papier übersät. Mein Bruder, der für jeden Unfug zu haben war, hat mich in einen Wäschekorb gesetzt und mich über zwei Etagen auf dem Papier hinunter sausen lassen.
Die ersten Bombenangriffe auf Hildesheim habe ich mit Interesse und Spannung erlebt. Meine Mutter hatte immer Angst und hat bei dem Gebrumm der amerikanischen Bomberschwärme oft den Staubsauger angestellt. Plötzlich fegten die Glassplitter der Fensterscheiben durch unsere Gardinen.
Dann doch runter in den Keller. Ein „Durchbruch“ zum Nachbarhaus wurde geöffnet. Es gab Trümmer und Tote. Ich selbst fand das immer noch spannend. Im Januar 45 habe ich mich –nach Aufruf- noch als Pimpf in der Michaelisstr. gemeldet. Ich wollte zum Fähnlein 3.
Nach einem weiteren Angriff auf Hildesheim am 22.02.45 hat meine Mutter einen entlaufenen KZ-Häftling bei uns versteckt. Er hieß Nico. Wir haben ihn versorgt und im Haus versteckt. Am 22. März bin ich mit ihm zusammen nach unserem Garten gefahren, um irgend etwas zu arbeiten. Nach Vorentwarnung kam wieder Fliegeralarm. Er hat mir gesagt: “Das bedeutet nichts Gutes. Laß uns nach Hause fahren“.
Als wir an der Ecke Moltkestr./Einumerstr. dicht bei unserem Haus waren, sahen wir schon die „Christbäume“ und Rauchzeichen der Pfadfinder-Flugzeuge. Dann krachten auch schon die ersten Bomben. So sind wir in den Luftschutzkeller der Gastwirtschaft „Deutscher Adler“ gestolpert. Zwischen den Bierfässern hat er sich als Schutz über mich gebeugt.
Nach furchtbaren 20 Minuten sind wir an die verwüstete und brennende Oberfläche gestiegen. Unser Haus war einigermaßen heil geblieben. Uli und ich haben versucht, brennende Häuser zu löschen; aber es gab kein Wasser, weil die Hauptwasserleitung zerbombt war.
Kurz vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen waren alle Vorratslager zum Plündern frei gegeben. Aus der Malzfabrik habe ich Marmelade geholt. Mein Bruder hat mich zum Stichkanal nach Steuerwald geschickt; dort gäbe es Waschpulver. Es waren alles weite Wege, die ich als 10 jähriger mit gefülltem Rucksack bewerkstelligen musste. In den inzwischen leeren Kasernen haben mich Stahlhelme mehr als Schuhe interessiert, die wir für unseren Holländer, der sehr große Füße hatte, suchten. Natürlich hatten wir keine Glasscheiben mehr in den Fenstern, sondern nur noch Pappe. Wenn dann vor unseren raren „Sehschlitzen“ noch ein amerikanischer Panzer stand, war alles duster.
Nach einigen Tagen klagte Nico über Halsschmerzen: „I kann niet schlucke“. Kurz nach der Befreiung ist der arme Kerl an Diphtherie im BK gestorben.--
Hanjo:
Als die Amerikaner in der Stadt einrücken, beobachteten wir einen Konvoi aus Lastwagen aus der sicheren Entfernung des Grundstückseingangs in der ein Nummer Straße 76 und versuchten, die Fahrzeuge, die vorbei fuhren, mit irgendwas zu bewerfen, vielleicht haben wir auch Zwillen benutzt.
Georg:
Auf einem der amerikanischen Lastwagen mit deutschen gefangenen Soldaten vor unserem Haus hat mein Bruder seinen früheren Sportlehrer, Aute Opitz, vom Josephinum erkannt. Uli hat ihm zugerufen:
„Aute, spring’ runter und komm zu uns!“ August Opitz hat aber geantwortet, er wolle nach Amerika (wo er vor dem Krieg schon einmal gewesen war). Gelandet ist er in einem Gefangenenlager in Frankreich.—
Nach 1945 haben wir Patronenhülsen mit Explosivstoff gefüllt, einen abgekniffenen Nagelkopf darüber und die Öffnung mit einem eingeklemmten Bindfaden verschlossen. Die „Geschosse“ haben wir in die Luft geschleudert. Beim Auftreffen sind diese Dinger explodiert. Leute haben sich erschreckt. Das war auch die Absicht. Gottlob, ist niemand durch die Splitter verletzt worden.
Hanjo:
In unserer alten Moltkeschule war ein Durchgangslager für deutsche Gefangene untergebracht worden.
Das Verbrennen der Schulbänke haben wir interessiert verfolgt.
Georg:
Aus diesem Durchgangslager Moltkeschule sind öfter deutsche Gefangene nachts über den Zaun geklettert und haben sich in unserem Haus versteckt. Deshalb kamen oft amerikanische Militärpolizisten zu Durchsuchungen in unser Haus. Meine Mutter und ich lagen nachts im Schlaf, als uns Amerikaner mit Taschenlampen anleuchteten und mit vorgehaltenem Revolver weckten. Meine Mutter war ganz entsetzt, weil ich den Soldaten gesagt habe:“ Ach, so einen hat mein Vater auch!“
Die geflüchteten deutschen Gefangenen stammten oft aus Dörfern in der Umgebung von Hildesheim oder hatten dort Bekannte. So habe ich einige nachts – trotz Sperrstunde d.h. Ausgehverbot – in die umliegenden Dörfer geführt und weite Wege zurückgelegt.
Hanjo:
Die amerikanischen Bewacher– Ich erinnere mich nur an farbige Soldaten – hatten am Zaun zum Grundstück einen Latrinengraben ausgehoben, den sie auch benutzten. Unser Stall-/Besenbinderhäuschen stand ja auch am Zaun - auf der anderen Seite - und diente im Oberteil unseren Zusammenkünften. Von dort aus unternahmen wir mit unseren Zwillen Schießübungen auf entblößte Bewacherhinterteile. Wir beobchteten auch, daß die Bewacher den Gefangenen Messer abnahmen und damit Wurfübungen auf Bäume am Zaun machten. Von diesen Messen haben wir einige 'erbeutet'.
Nicht erinnern kann ich mich, aus welchem Grunde wir den Lehm aus den Balkenfugen kratzten und auf "Angreifer" mit dem Kriegsruf "Mööölm" niedergehen ließen.
In der Moltkeschule war ein Durchgangslager für deutsche Kriegsgefangene eingerichtet worden. An allen Ecken standen amerikanische Posten mit MG. Die Verpflegung und Behandlung der Gefangenen war schlecht. Ich habe selbst gesehen, wie Amerikaner deutsche Offiziere, die auf dem Schulhof im Kreis laufen mussten, mit Steinen beworfen haben. Einen jungen deutschen Soldaten haben sie gezwungen, sein Grab zu schaufeln. Der junge Kerl hat geheult und um sein Leben gebettelt. Ich kann aber nicht sagen, ob es wirklich zu einer Erschießung gekommen ist. Meine Mutter hat für die Soldaten Suppe und Tee gekocht.
Die Suppe und Getränke, die meine Mutter für die gefangenen deutschen Soldaten auf dem Moltke-Schulhof gekocht hatte, haben wir durch den Zaun gereicht. Dort stand ein „befreiter“ Marokkaner oder Algerier, der wohl in Nord-Afrika als Gefangener nach Deutschland gekommen war. Er war als Aufseher über die deutschen Soldaten nur mit einer Zaunlatte bewaffnet und hat auf gutes Zureden von meiner Mutter auf Französisch die Übergabe der Suppe durch den Zaun großzügig erlaubt.
Hanjo:
Auch Frauen aus der Lessingstraße haben über die angrenzenden Grundstücke den Gefangenen Essen zukommen lassen.
Ich erinnere mich auch an Käsekonserven in Tuben, die wir aus Lagern am Hafen 'organisiert' hatten und über den Zaun warfen.
Die Wache der Amerikaner hatte sich 2 Häuser weiter von unserem Haus einquartiert. Alle Bewohner mussten das Haus räumen. Eine Familie davon ist bei uns untergekommen.
Überhaupt hatten wir immer ein volles Haus. Abgesehen von gelegentlichen Einquartierungen in der Kriegszeit kamen 1944 unsere Verwandten aus Aachen (Stommel) und aus Leverkusen (Nolte) zu uns nach Hildesheim. Nach Ende der Kampfhandlungen kamen die Flüchtlinge aus dem Osten (Hartung und Madle und Eichstädt). So habe ich die weitläufigen Mitglieder der Familie kennen gelernt.
Unter den Flüchtlingen, die bei uns Unterschlupf fanden, war auch eine hübsche junge Schweizerin aus Ostpreußen, Bärbel Ruoss, die auf der Flucht von ihren Eltern getrennt worden war. Ich hätte sie gerne als Ulis Frau gesehen. Sie ist aber nach Zürich gegangen und hat dort einen Schweizer (Gygax) geheiratet. Auf einer Rückreise aus Süd-Frankreich haben mich die beiden für einen Tag sehr freundlich aufgenommen. Später sind sie in die USA ausgewandert.
Nach dem Krieg war die Wohnungsnot sehr groß. Auch das Haus meiner Eltern war mit Flüchtlingen gut besetzt. Ein Zimmer war „out of bounds“, weil dort Frl. Henne wohnte, die als Dolmetscherin für eine englische Behörde arbeitete. In 1 ½ Zimmern in der oberen Etage wohnte eine jüdische Familie,
Gross, Eltern mit 2 halbwüchsigen Kindern, die ein KZ überlebt hatten. In einem Zimmer wohnte einer meiner Cousins, Karl-Heinz Madle, der als U-Boot-Offizier aus der Gefangenschaft entlassen war. Und so ging es weiter.
Eines Tages kam ein junger Mann vom Wohnungsamt und wollte noch ein weiteres Zimmer beschlagnahmen. Das war ein Herr Fräßdorf. Mein Bruder Uli hat ihm unsere Situation geschildert; und als das noch nicht half, hat er diesen Mann ziemlich grob beschimpft und des Hauses verwiesen.
Ich bin dabei gewesen.
Einige Wochen später wurde mein Klassenlehrer, Herr Hobrecht, Rektor an der Moltkeschule. Ich bekam einen neuen Klassenlehrer, Herrn Fräßdorf. Als er den „Klassenspiegel“ durchlas und alle Schüler sich vorstellen mussten, hat er bei mir gesagt:“ Ach, dich kenne ich ja schon!“
Herr Fräßdorf ist ein Freund meiner Eltern geworden.
Ich denke gerne an meine Kinder- und Jugendjahre zurück.
Nach dem Großangriff auf Hildesheim hatten wir über Monate weder Wasser, Elektrizität noch Gas.
Das Gute an der Sachlage war, daß wir Kinder auch keine Schule hatten. Wasser musste ich in Eimern entweder von Wasserwagen holen, die manchmal kamen oder von einer Pumpe, die ich im Keller eines zerstörten Hauses gefunden hatte.
Wir lebten in der Küche, die in unserem Haus Einumerstr. 76 im Keller war, um den Senking-Herd herum. Natürlich stand bei uns auch ein Sofa in der Küche. In einer zerschossenen Lokomotive hinter unserem Garten habe ich im Tender Kohlen gefunden. Die haben wir mit dem Bollerwagen bei Dunkelheit nach Hause geschafft und vorsichtshalber die hinterlassene Kohlenstaubspur weggefegt.
In den Trümmern haben wir gerne gespielt und Kämpfe zwischen den Kindern der Lessingstr. , zu denen ich zeitweise gehörte, und der Schillerstrasse. Wir hatten Stahlhelme auf und haben uns über die Einumerstaße hinweg mit Trümmerbrocken beworfen. Manchmal fuhren unter unserem Steinhagel auch amerikanische Lastwagen durch. Holz zum Heizen haben wir aus den Trümmern geholt. Selbst auf den Andreaskirchturm sind wir geklettert. Dort oben hatte sich eine herabgestürzte Glocke zwischen 2 Eisenträgern verklemmt. Wir haben Balken von der Höhe des Turmes hinunter geworfen, die wir unten als Kleinholz auf den Bollerwagen laden konnten. Aus den Bleirippen der zerstörten Kirchenfenster haben wir Geschosse für unsere Zwillen gefertigt.
Lieber Georg,
es ist erstaunlich, was Du noch an Einzelheiten aufführen kannst.
Wann hast Du das alles geschrieben? Hast Du sehr darüber nachdenken müssen, oder sind Dir die Erinnergungen geläufig?
Vielleicht würde mir auch noch so einiges einfallen, ich habe aber nie den Versuch gemacht. Allerdings ist die Zeit um die Moltkeschule noch relativ frisch - wir sprachen ja schon darüber - , und vieles kann ich gut nachvollziehen. Auch das „Organisieren“ aus den alten Beständen ist mir geläufig (Käsetuben vom Hafen für die Kriegsgefangenen z.B.).
Deine Zeilen haben natürlich auch fast Vergessenes wieder reanimiert.
Dazu gehören aber nicht die Eindrücke - im wahrsten Sinne des Wortes - aus der Trümmerlandschaft. Was Du vom Marktplatz schreibst, habe ich auch gesehen, und es hat mich immer verfolgt, ich habe eigentlich mit niemandem darüber gesprochen, vielleicht weil ich diese Erlebnisse nicht vertiefen wollte, sie haben mich nur immer denken lassen, daß man als junger Mensch ohne solche Erfahrungen heutzutage zwangsläufig zu anderen Betrachtungsweisen kommt.
In jener, noch zerstörungsfreien, Zeit hatte ich mein zweites Zuhause bei meiner Großmutter mütterlicherseits an der Zingel. Im Erdgeschoß war eine Arztpraxis, ich glaube, es war die von Dr. Kaiser. Im Hintergebäude des benachbarten Hauses befand sich auch ein Gefangenenlager, derzeit aber natürlich noch für französische, belgische und andere Kriegsgefangene. Einige waren auch als Handwerker im Haus bei meiner Großmutter untergebracht. Wir hatten als Kinder ein spielerisches freundschaftliches Verhältnissen zu ihnen; seit jener Zeit weiß ich, daß man Geschirr, speziell Kochgeschirr, sehr gut mit Sand putzen kann. Nach den Angriffen, bei denen auch ein Teil meine Kindersachen verbrannten, war ich noch einmal in den Restkellern des Hauses und habe darüber gestaunt, wie biegsam Glas durch Hitze werden kann. Als Ersatzluftschutzmelder mit Stahlhelm und Santitätstasche (von meinem als Flakhelfer eingezogenem Bruder übernommen ‘worden’) hatte ich wohl ein sicheres Besichtigungsrecht, meinte ich. Unsere Großmutter führte von da an den Haushalt in der Einumerstaße, und die Dreigenerationenwelt ist mir sicher gut bekommen.
Ja, Aufräumen gehörte damals einfach dazu. Wir waren in der Andreaskirchenruine aktiv, um in der alten Sakristei einen Andachts- und einen Jugendraum einrichten zu können. Natürlich waren wir wir auch im Turmgerüst. Ich füge ein paar Fotos bei, die ich auch für den jetzigen Küster der Andreaskirche zur Verfügung gestellt habe, der an Archivdingen interessiert ist, wie ich bei der Trauerfeier für meinen Bruder erfahren habe.
Und dann habe ich beim Stöbern im Internet einen Artikel gefunden, der auch das Fähnlein 3 erwähnt; über meines, das Fähnlein 5, habe ich nichts gefunden. Die Internetadresse füge ich auch bei.
Bei der erwähnten Trauerfeier hat es natürlich auch Gespräche aus der Zeit der Jugendarbeit gegeben, allerdings sind Deine und meine Erinnerungen aus der Zeit davor noch solitär.
Nun, ichwollte Dich mit meiner Reaktion nicht zu lange warten lassen. Es gäbe noch vieles hinzuzufügen; vielleicht kommt das im Laufe der Zeit.
Dir und Deiner Frau, sowie Eurer Tochter, herzliche Grüße vom Bodensee,
auch von meiner besseren Hälfte.
auch von meiner besseren Hälfte.
Hanjo